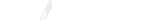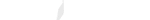Mitte August hat das Umweltbundesamt eine
TV nach dreieinhalb Jahren nicht mehr reparierbar
Mehrere Käufer eines 2.700 Euro teuren Philips-Fernsehers, der von Stiftung Warentest damals sogar zum Testsieger gekürt worden war, berichteten, dass das Gerät nach dreieinhalb Jahren defekt war. Das Erstaunliche: Philips führte nach dieser für ein TV-Gerät vergleichsweise kurzen Lebenszeit bereits keine Ersatzteile mehr für das Modell, eine Reparatur war daher nicht möglich.
Für die Rücksendung des defekten Geräts zum Kunden wollte Philips 251 Euro berechnen, eine Entsorgung beim Hersteller hätte immerhin noch 152 Euro kosten sollen. Der Philips-Kundendienst schrieb einem anderen Kunden "Leider können aufgrund unvorhersehbarer Gründe Ersatzteile vorschnell vergriffen sein". Eine Nachproduktion sei aber nicht rentabel. Ähnlich gehen viele Unternehmen vor.
Stiftung Warentest: Geräte gehen nicht schneller kaputt als früher
Es liegt auf der Hand, dass Hersteller und Handel an möglichst kurzen Wiederverkaufszyklen interessiert sind. Die Erkenntnisse aus Dauertests der Stiftung Warentest aus den vergangenen zehn Jahren lieferten allerdings keine Hinweise auf eine von den Herstellern bewusst geplante, kurze Lebensdauer von Produkten. Haushaltsgeräte würden heute nicht schneller kaputt gehen als früher. Billigere Geräte erwiesen sich erwartungsgemäß aber meist als anfälliger für Defekte. Bei Akkubohrern unter 50 Euro, Staubsaugern unter 80 Euro, Entsaftern unter 60 Euro und Stabmixern unter 20 Euro steigt beispielsweise das vorzeitige Ausfallrisiko.
Die Reparatur eines Gerätes lohnt sich laut Stiftung Warentest oft nicht mehr oder ist gar nicht mehr möglich.
Bild: Shutterstock.com /
Häufig führen aber auch billige Verschleißteile zum schnellen Aus für das komplette Gerät. Als Beispiel führt Stiftung Warentest Staubsauger an: Vier von fünf Staubsaugern fallen wegen defekter Kohlebürsten im Motor aus. Für robustere Geräte müssen die Verbraucher entsprechend mehr Geld auf die Ladentheke legen. Das Ziel der Hersteller ist laut Albert Albers, Leiter des IPEK Institut für Produktentwicklung am Karlsruher Institut für Technologie, "ein Gerät so gut wie nötig zu bauen, nicht so gut wie möglich. Sonst laufen die Kosten aus dem Ruder". Nur in den seltensten Fällen macht ein Hersteller Angaben zur vermutlichen Lebenszeit eines Produkts.
Eine Reparatur lohnt sich bei vielen Geräten nicht mehr. Der Austausch des Motors bei einer ab 762 Euro erhältlichen Bosch-Waschmaschine würde beispielsweise mit 299 Euro zu Buche schlagen. Bei einem billigen DVD-Player oder Drucker kommt ein Neukauf meist günstiger. Vielfach ist aber eine Reparatur bereits aus Konstruktionsgründen ausgeschlossen: Bauteile sind verklebt oder aber Akkus wie in einem
Alternativer Ansatz: Dienstleistung statt nur das Produkt verkaufen
Immer häufiger helfen sich Verbraucher selbst und setzen auf Reparaturanleitungen, die sich im Internet finden. Bastlern machen die Hersteller das Leben aber teils schwer, indem für die Reparatur mancher Geräte ein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Apple baute laut den Experten von Stiftung Warentest beispielsweise in mehrere iPhone- und MacBook-Modelle eigens entwickelte Pentalob-Schrauben ein.
Eine innovative Idee, die sowohl Herstellern als auch Verbrauchern entgegenkommt, propagiert Michael Braungart, Leiter der Hamburger Beratungsfirma EPEA Internationale Umweltforschung. "Hersteller sollten nicht mehr Waschmaschinen verkaufen, sondern die Dienstleistung Waschen", so Braungart. Das Prinzip: Der Kunde bekommt beim Kauf eine Waschmaschine gestellt, der Reparaturservice ist bereits inklusive. Nach beispielsweise 2.000 Wäschen wird die Maschine wieder vom Hersteller abgeholt und recycelt. Der Kunde würde ein neues Gerät erhalten.
Der komplette, siebenseitige Bericht der Stiftung Warentest findet sich in der aktuellen September-Ausgabe von "test". Alternativ ist das Special "Geplante Obsoleszenz" kostenpflichtig unter
Quelle: onlinekosten
Sie müssen registriert sein, um Links zu sehen.
in Auftrag gegeben. Wissenschaftlich untersucht werden soll unter anderem, ob Hersteller vielleicht bewusst Produkte so konstruieren, dass sie kurz nach der Gewährleistungszeit kaputt gehen. Auch die Stiftung Warentest sucht in ihrem aktuellen Testmagazin (
Sie müssen registriert sein, um Links zu sehen.
) nach Spuren für diesen Verdacht. Die Tester stießen auf etliche Fälle und Indizien, die für Verbraucher besonders ärgerlich sind.TV nach dreieinhalb Jahren nicht mehr reparierbar
Mehrere Käufer eines 2.700 Euro teuren Philips-Fernsehers, der von Stiftung Warentest damals sogar zum Testsieger gekürt worden war, berichteten, dass das Gerät nach dreieinhalb Jahren defekt war. Das Erstaunliche: Philips führte nach dieser für ein TV-Gerät vergleichsweise kurzen Lebenszeit bereits keine Ersatzteile mehr für das Modell, eine Reparatur war daher nicht möglich.
Für die Rücksendung des defekten Geräts zum Kunden wollte Philips 251 Euro berechnen, eine Entsorgung beim Hersteller hätte immerhin noch 152 Euro kosten sollen. Der Philips-Kundendienst schrieb einem anderen Kunden "Leider können aufgrund unvorhersehbarer Gründe Ersatzteile vorschnell vergriffen sein". Eine Nachproduktion sei aber nicht rentabel. Ähnlich gehen viele Unternehmen vor.
Stiftung Warentest: Geräte gehen nicht schneller kaputt als früher
Es liegt auf der Hand, dass Hersteller und Handel an möglichst kurzen Wiederverkaufszyklen interessiert sind. Die Erkenntnisse aus Dauertests der Stiftung Warentest aus den vergangenen zehn Jahren lieferten allerdings keine Hinweise auf eine von den Herstellern bewusst geplante, kurze Lebensdauer von Produkten. Haushaltsgeräte würden heute nicht schneller kaputt gehen als früher. Billigere Geräte erwiesen sich erwartungsgemäß aber meist als anfälliger für Defekte. Bei Akkubohrern unter 50 Euro, Staubsaugern unter 80 Euro, Entsaftern unter 60 Euro und Stabmixern unter 20 Euro steigt beispielsweise das vorzeitige Ausfallrisiko.
Du musst angemeldet sein, um Bilder zu sehen.
Die Reparatur eines Gerätes lohnt sich laut Stiftung Warentest oft nicht mehr oder ist gar nicht mehr möglich.
Bild: Shutterstock.com /
Sie müssen registriert sein, um Links zu sehen.
Häufig führen aber auch billige Verschleißteile zum schnellen Aus für das komplette Gerät. Als Beispiel führt Stiftung Warentest Staubsauger an: Vier von fünf Staubsaugern fallen wegen defekter Kohlebürsten im Motor aus. Für robustere Geräte müssen die Verbraucher entsprechend mehr Geld auf die Ladentheke legen. Das Ziel der Hersteller ist laut Albert Albers, Leiter des IPEK Institut für Produktentwicklung am Karlsruher Institut für Technologie, "ein Gerät so gut wie nötig zu bauen, nicht so gut wie möglich. Sonst laufen die Kosten aus dem Ruder". Nur in den seltensten Fällen macht ein Hersteller Angaben zur vermutlichen Lebenszeit eines Produkts.
Eine Reparatur lohnt sich bei vielen Geräten nicht mehr. Der Austausch des Motors bei einer ab 762 Euro erhältlichen Bosch-Waschmaschine würde beispielsweise mit 299 Euro zu Buche schlagen. Bei einem billigen DVD-Player oder Drucker kommt ein Neukauf meist günstiger. Vielfach ist aber eine Reparatur bereits aus Konstruktionsgründen ausgeschlossen: Bauteile sind verklebt oder aber Akkus wie in einem
Sie müssen registriert sein, um Links zu sehen.
fest eingebaut. Als Schwachstelle haben sich in Elektrogeräten auch Elektrolytkondensatoren gezeigt, die größerer Wärme im Gerät nur eine Zeit lang widerstehen können.Alternativer Ansatz: Dienstleistung statt nur das Produkt verkaufen
Immer häufiger helfen sich Verbraucher selbst und setzen auf Reparaturanleitungen, die sich im Internet finden. Bastlern machen die Hersteller das Leben aber teils schwer, indem für die Reparatur mancher Geräte ein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Apple baute laut den Experten von Stiftung Warentest beispielsweise in mehrere iPhone- und MacBook-Modelle eigens entwickelte Pentalob-Schrauben ein.
Eine innovative Idee, die sowohl Herstellern als auch Verbrauchern entgegenkommt, propagiert Michael Braungart, Leiter der Hamburger Beratungsfirma EPEA Internationale Umweltforschung. "Hersteller sollten nicht mehr Waschmaschinen verkaufen, sondern die Dienstleistung Waschen", so Braungart. Das Prinzip: Der Kunde bekommt beim Kauf eine Waschmaschine gestellt, der Reparaturservice ist bereits inklusive. Nach beispielsweise 2.000 Wäschen wird die Maschine wieder vom Hersteller abgeholt und recycelt. Der Kunde würde ein neues Gerät erhalten.
Der komplette, siebenseitige Bericht der Stiftung Warentest findet sich in der aktuellen September-Ausgabe von "test". Alternativ ist das Special "Geplante Obsoleszenz" kostenpflichtig unter
Sie müssen registriert sein, um Links zu sehen.
online abrufbar. Quelle: onlinekosten