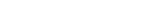Hartz IV Urteil: Erbschaft ist Vermögen
Eine Erbschaft während ALG II Bezugs ist Vermoegen. Streitig war, ob eine Erbschaft beim Bezug von Arbeitslosengeld II (Alg II) als Vermögen oder Einkommen zu berücksichtigen ist.
Der am 00.00.1956 geborene Kläger zu 1), die am 00.00.1958 geborene Klägerin zu 2) und deren am 00.00.1993 und am 00.00.1994 geborenen Kinder, die Kläger zu 3) und 4), standen bei der Beklagten seit Januar 2005 im laufenden Leistungsbezug. Zuletzt wurden mit Bescheid vom 16.11.2006 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende in Höhe von 786,53 EURO monatlich für die Zeit von Dezember 2006 bis Mai 2007 bewilligt.
Am 15.01.2007 erhielten die Kläger eine Zahlung von 21.228,57 EURO. Das Geld stammte aus einer Erbschaft, worüber die Kläger die Beklagte auch noch im Januar 2007 informierten. Die Klägerin zu 2) hatte ihren am 13.05.2006 verstorbenen Vater beerbt. Die Beklagte stellte hierauf die Leistungen ab März 2007 - zunächst ohne Erlass eines Bescheids - ein und hob die Leistungsbewilligung vom 16.11.2006 nach Anhörung der Kläger ab Februar 2007 mit Bescheid vom 07.05.2007 auf. Die den Klägern zugeflossene Erbschaft stelle Einkommen dar, das als einmalige Einnahme auf einen angemessenen Zeitpunkt zu verteilen sei. Die Kläger könnten ihren Lebensunterhalt von der Erbschaft für 26 Monate selbst bestreiten. Die Erbschaft sei ab Februar 2007 anzurechnen, weshalb es im Februar 2007 zu einer Überzahlung in Höhe von 786,53 EURO gekommen sei, die zu erstatten sei. Ab März stünden keine Leistungen mehr zu.
Im Widerspruchsverfahren trugen die Kläger vor, dass die Erbschaft als Vermögen zu bewerten sei und deshalb die für Vermögen anzusetzenden Freibeträge zu berücksichtigen seien. Der Kläger zu 1) habe einen Freibetrag von 7.500,00 EURO, die Klägerin zu 2) einen Freibetrag von 7.200,00 EURO und die Kinder jeweils einen Freibetrag von 3.100,00 EURO (20.900,00). Aus diesem Grund sei es zu keiner Überzahlung gekommen. Der Widerspruch wurde von der Beklagten Ende Mai 2007 als unbegründet zurückgewiesen. Die Kläger haben am 06.06.2007 Klage erhoben, die sie auf die bereits im Widerspruchsverfahren bereits vorgetragenen Begründung stützen.
Die Kläger beantragen,
die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 07.05.2007 in Gestalt des Widerspruchbescheids vom 30.05.2007 zu verpflichten, an die Kläger Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Februar bis Mai 2007 zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichts- und Verwaltungsakten verwiesen, deren wesentlicher Inhalt Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen ist.
Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zulässig und begründet. Der angegriffene Bescheid ist rechtswidrig und die Kläger sind daher in ihren Rechten gemäß § 54 Abs. 2 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) verletzt. Die Beklagte durfte den Bewilligungsbescheid vom 16.11.2006 nicht aufheben und die Leistungen für Februar 2007 zurückfordern bzw. ab März 2007 einstellen, da die Kläger auch über Januar 2007 hinaus Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende hatten.
Gemäß § 48 Abs. 1 Satz 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - (SGB X) ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben, soweit in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die beim Erlass des Verwaltungsaktes vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung eintritt. Nach § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB X soll der Verwaltungsakt mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufgehoben werden, soweit nach Antragstellung oder Erlass des Verwaltungsaktes Einkommen oder Vermögen erzielt worden ist, das zum Wegfall oder zur Minderung des Anspruchs geführt haben würde. Die Beklagte war der Ansicht, dass die aus einer Erbschaft aus Mai 2006 stammende und den Klägern im Januar 2007 zugeflossene Zahlung Einkommen darstellt, das auf 26 Monate zu verteilen sei und den Bedarf der Kläger für diesen Zeitraum decke. Aus diesem Grund sollen die Voraussetzungen von § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 vorgelegen haben. Diese Ansicht ist unzutreffend. Die Kläger hatten auch in der Zeit von Februar bis Mai 2007 Anspruch auf Alg II.
Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB II) erhalten Leistungen nach diesem Buch Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (erwerbsfähige Hilfebedürftige). Hilfebedürftig ist gemäß § 9 Abs. 1 SGB II, wer seinen Lebensunterhalt, seine Eingliederung in Arbeit und den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem nicht 1. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, 2. aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhält. Die Kläger konnten ihren Lebensunterhalt ab Februar 2007 weder aus zu berücksichtigendem Einkommen noch aus zu berücksichtigendem Vermögen bestreiten. Daran änderte insbesondere auch die im Mai 2006 angefallene und den Klägern im Januar 2007 ausgezahlte Erbschaft nichts. Denn die von der Beklagten als Einkommen bewertete Erbschaft stellte Vermögen dar (hierzu unter 1), das unterhalb der Freibeträge der Kläger nach § 12 Abs. 2 Nr. 1, 1a und 4 SGB II lag (hierzu unter 2) und daher nicht zu berücksichtigen war.
1. In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, wie eine Erbschaft während des Bezugs von Alg II einzuordnen ist. Während in der Literatur teilweise vertreten wird, dass eine während des Bezugs von Alg II erhaltene Erbschaft Vermögen ist (Brühl in LPK-SGB II, § 11 Rn. 9), geht die Rechtsprechung zum Alg II bislang – soweit ersichtlich einhellig – davon aus, dass zumindest Geldzuflüsse aufgrund einer Erbschaft während des Leistungsbezugs Einkommen darstellen. Diese Ansicht wendet die so genannte "Zuflusstheorie" an, der zu Folge Einkommen alles ist, was der Hilfebedürftige während eines Zahlungszeitraums wertmäßig dazu erhält, während Vermögen das ist, was er bei Beginn eines Zahlungszeitraums bereits hat (vgl. nur LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 23.03.2006, L 20 B 72/06 AS; LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 21.02.2007, L 7 AS 690/07 ER-B m.w.N.). Die Zuflusstheorie wird unter anderem auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Bundessozialhilfegesetz (BSHG) gestützt, in welchem die Zahlung aufgrund eines geerbten Unterhaltsanspruchs als Einkommen gewertet worden war (BVerwG, Urteil vom 18.02.1999, 5 C 16/98).
Diese Auffassung überzeugte die Kammer nicht. Unter Einkommen werden umgangssprachlich mehr oder weniger regelmäßige Geldzahlungen gefasst. Auch das Bundessozialgericht hatte zur Arbeitslosenhilfe entschieden, dass eine Erbschaft Vermögen und kein Einkommen darstellt (BSG, Urteil vom 17.03.2005, B 7a/7 AL 10/04 R). Diese Entscheidung entspricht der üblichen Auslegung des Einkommensbegriffs.
Im Steuerrecht ist gemäß § 2 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) Einkommensteuer zu zahlen für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte nach § 22 EStG (Unterhaltsleistungen, Pensionen, Renten, Erlöse aus privaten Veräußerungsgeschäften etc. unter bestimmten Voraussetzungen). Es mag zwar sein, dass der im Steuerrecht geltende Einkommensbegriff nicht auf den Einkommensbegriff des SGB II übertragbar ist (so LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 23.03.2006, L 20 B 72/06 AS). Er ist jedoch bei der Auslegung des Begriffs "Einkommen" auch nicht völlig außer Acht zu lassen. Den in § 2 Abs. 1 EStG und fast allen in § 20 EStG aufgeführten Einnahmen ist gemeinsam, dass es sich um im Regelfall wiederkehrende Leistungen handelt, die außerdem verfügbare Geldmittel darstellen. Eine Erbschaft hingegen ist immer ein einmaliger Zufluss und passt schon allein deshalb nicht in das Schema der übrigen Einkommensarten. Ferner ist eine Erbschaft nicht selten mit erheblichen Verwertungshindernissen verbunden und führt daher in den wenigsten Fällen zu sofort verfügbaren Geldmitteln.
In § 11 Abs. 1 SGB II wird Einkommen definiert als "Einnahmen in Geld oder Geldeswert" und scheint umfassender zu sein als der Begriff des Einkommens. Das führt jedoch nicht dazu, dass ausnahmslos alles, was einem Hilfebedürftigen im Bezugszeitraum zufließt, hierunter subsumiert werden muss. In der Gesetzesbegründung zu § 11 SGB II heißt es, dass die Einkommensanrechnung im Wesentlichen wie im Sozialhilferecht geregelt werde, so wie § 12 SGB II die Vermögensberücksichtigung im Wesentlichen wie die Arbeitslosenhilfe regele (BT-Drucks. 15/1516 S. 53). Da Erbschaften im Rahmen der Arbeitslosenhilfe als Vermögen betrachtet wurden, könnte hieraus geschlossen werden, dass sie auch beim Arbeitslosengeld II als Vermögen bewertet werden sollten. Die Kammer hielt diese Sichtweise für angezeigt, da die von der Praxis bislang vorgenommene Einordnung von Erbschaften als Einkommen entweder zu Ungereimtheiten (hierzu unter a.), zu Regelungslücken (hierzu unter b.) oder zu einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung führt (hierzu unter c.). Eine in sich stimmige Lösung ergibt sich nur, wenn Erbschaften als Vermögen angesehen werden.
a. In der Verwaltungspraxis wird – soweit die Kammer dies bislang feststellen konnte – so verfahren, dass Erbschaften erst dann als Einkommen berücksichtigt werden, wenn es zur Verwertung der geerbten Vermögenswerte und einer Auszahlung des Erlöses an den Alg II beziehenden Erben kommt. Diese Vorgehensweise ist inkonsequent. Entweder ist eine Erbschaft von Anfang an, also mit dem Erbfall, als Einkommen zu betrachten, das - je nachdem aus welchen Positionen die Erbmasse besteht - als Geld- oder Sachbezug einzuordnen ist, oder die Erbschaft ist von Anfang an als Vermögen zu bewerten. Und wenn eine Erbschaft beim Erbfall zunächst als Vermögen angesehen und demnach nicht als einmalige Einnahme auf einen angemessenen Zeitraum verteilt werden würde, wäre auch der Veräußerungserlös aus diesem Vermögenswert kein Einkommen, sondern Vermögen. Es entsprach bereits höchstrichterlicher Rechtsprechung zur Arbeitslosenhilfe, dass der Veräußerungserlös aus einem im Vermögen befindlichen Gegenstand zum Verkehrswert kein Einkommen darstellt, sondern weiterhin Vermögen ist (BSG, Urteil vom 17.03.2005, B 7a/7 AL 10/04 R; BSG, Urteil vom 20.06.1978, 7 Rar 47/77). Diese Rechtsprechung ist auf den Bezug von Arbeitslosengeld II zu übertragen (so auch Mecke in: Eicher/Spellbrink, SGB II, § 11 Rn. 23). Denn der erhaltene Kaufpreis rückt praktisch an die Stelle des verkauften Gegenstandes.
Es gibt auch keinen Grund von diesem Grundsatz bei Erbschaften eine Ausnahme zu machen. Gemäß § 1922 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geht mit dem Tod einer Person (Erbfall) deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine oder mehrere Personen (Erben) über. Anders als beim Vermächtnis, das gemäß § 1939 BGB eine Zuwendung an eine Person darstellt, ohne diese als Erben einzusetzen und das daher lediglich eine Forderung begründet, führt die Rechtsstellung als Erbe dazu, dass der Erbe (Gesamthand)-Eigentümer am Vermögen des Erblassers wird und somit beispielsweise Gesamthandeigentümer eines Grundstücks, eine Autos, Gesamthandinhaber eines Sparbuchs oder Bankkontos oder Aktiendepots etc. wird. Werden einzelne oder alle geerbten Vermögenswerte aus der Erbmasse veräußert und der Erlös an den oder die Erben ausgezahlt, ändert dies nach Auffassung der Kammer nichts an der rechtlichen Einordnung des vorher in einem Sachwert und nun in Form von Geld vorhandenen Vermögensgegenstandes.
Die Verwaltungspraxis, die einen Einkommenszufluss offenbar erst zum Zeitpunkt der Auszahlung des Veräußerungserlöses annimmt, verstößt gegen den Grundsatz, dass der Erlös aus der Verwertung eines Vermögensgegenstands Vermögen bleiben muss und ist daher abzulehnen.
b. Um die unter 1. a beschriebene Ungereimtheit zu lösen, müsste entweder sowohl der Erwerb der Erbmasse als auch der spätere Veräußerungserlös als Vermögen eingeordnet oder beides als Einkommen bewertet werden. Die Einordnung von Sachbezügen als Einkommen ist durch § 2 Abs. 4 der Verordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen beim Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung - Alg II-VO) grundsätzlich möglich und wurde in der Rechtsprechung auch bei einmaligen "Sachbezügen" von größerem Wert bereits vorgenommen. So wurde beispielsweise in einer Entscheidung des Sozialgerichts Duisburg ein gewonnener Pkw mit einem Wert von rund 18.000,00 EURO als Einkommen bewertet und angenommen, dass dieses "Einkommen" die Hilfebedürftigkeit für 10 Monate entfallen lasse (SG Duisburg, Urteil vom 19.03.2007, S 27 AS 59/07 ER). Dieses Urteil ist bei Anwendung der Zuflusstheorie konsequent, führt aber - je nachdem was für ein Sachwert einem Hilfebedürftigen zufließt - zu folgender Regelungslücke, die die Schwächen der Zuflusstheorie belegt: Wenn beispielsweise ein Hilfebedürftiger mit einem Vermögensfreibetrag von 9.000,00 EURO im Leistungsbezug Erbe eines kleinen Grundstücks würde, das 8.000,00 EURO wert ist, müsste er das geerbte Grundstück – bei Einordnung der Erbschaft als Einkommen – ohne Berücksichtigung von Freibeträgen zum Lebensunterhalt verwenden. Bei konsequenter Anwendung von § 11 Abs. 1 SGB II in Verbindung mit § 2 Abs. 3 und 4 Alg II-VO müsste sein Fortzahlungsantrag abgelehnt werden bzw. eine noch laufende Bewilligung aufgehoben werden. Er stünde dann vor dem Problem, dass er mit dem Grundstück kaum Miete, Essen oder ähnliches bezahlen könnte, da ihm der Wert des Gegenstandes nicht in Geld zu Verfügung steht. Er wäre daher überhaupt nicht in der Lage, seinen Lebensunterhalt ohne Alg II zu bestreiten, da sein vermeintliches "Einkommen" nicht sofort verwertbar wäre.
Für den Fall, dass einem Hilfebedürftigen der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung von zu berücksichtigendem Vermögen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, regelt § 23 Abs. 5 SGB II, die darlehensweise Gewährung von Alg II. Für Einkommen, dessen sofortiger Verbrauch oder dessen sofortige Verwertung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, fehlt es hingegen an einer entsprechenden Vorschrift. Dies ist nach Auffassung der Kammer kein Versehen des Gesetzgebers mit der Folge, dass diese Lücke durch eine Analogie behoben werden müsste (so aber offenbar SG Duisburg, a.a.O.), sondern zeigt vielmehr, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass Einkommen immer dazu verwendet werden kann, den laufenden Lebensunterhalt in irgendeiner Form zu bestreiten und es insoweit keine Verwertungshindernisse geben kann. Die vermeintliche Regelungslücke entsteht allein dadurch, dass die Verwaltungspraxis und die bisherige Rechtsprechung zum Alg II Erbschaften und somit einen einmaligen und im Regelfall nicht sofort verwertbaren Zufluss zum Einkommen zählt, obwohl Erbschaften in der Arbeitslosenhilfe nicht und in der Sozialhilfe bislang nur bei einer Zahlung aufgrund einer geerbten Geldforderung als Einkommen betrachtet worden sind.
c. Der Kammer war nicht bekannt, aus welchen Vermögensgegenständen die der Klägerin zu 2) zugeflossene Erbschaft im Einzelnen bestand, also ob es sich um Bankguthaben, Grundstücke oder andere Vermögenswerte handelte. Aus diesem Grund sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass eine Erbschaft auch dann kein Einkommen darstellt, wenn sie Barmittel zum Gegenstand hat, bei denen die unter 1. b. beschriebenen Verwertungsschwierigkeiten nicht bestehen (beispielsweise in Form eines Bankkontos oder Bargelds). Denn eine Unterscheidung zwischen der Art des geerbten Vermögensgegenstandes (so offenbar LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 21.02.2007, L 7 AS 690/07 ER-B) wäre eine sachlich nicht gerechtfertigte Schlechterstellung von geerbten Barmitteln gegenüber geerbten Sachwerten. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Steuerrecht bereits in mehreren Entscheidungen festgestellt, dass es gegen Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) verstößt, wenn Erben bestimmter Vermögensarten ohne sachlichen Grund schlechter gestellt werden als andere Erben - insbesondere Erben von Geldmitteln im Vergleich zu Erben von Immobilien (BVerfG, Beschluss vom 07.11.2006, 1 BvL 10/02; BVerfG, Beschluss vom 22.06.1995, 2 BvR 552/91). Eine solche Ungleichbehandlung hält die Kammer nicht nur im Steuerrecht für gleichheitswidrig, sondern auch im SGB II. Aus diesem Grund muss bei der Einordnung von Zuflüssen zu Einkommen oder Vermögen eine Erbschaft von Barmitteln genauso wie eine Erbschaft von Sachmitteln behandelt werden. Exclamation Exclamation
Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Erbschaften egal wann und in welcher Form sie zufließen als Vermögen einzustufen sind, um weder die unter 1. a. beschriebenen Ungereimtheiten, noch die unter 1. b. beschriebenen Regelungslücken zu verursachen, geschweige denn die unter 1. c. beschriebene Ungleichbehandlung vorzunehmen.
2. Das von der Klägerin zu 2) geerbte Vermögen lag auch unter den für die Kläger geltenden Freibeträgen. Aus § 12 Abs. 2 Nr. 1 SGB II ergibt sich für den Anfang 2007 50 Jahre alten Kläger zu 1) ein Freibetrag von 7.500,00 EURO und für die 48 Jahre alte Klägerin zu 2) ein Freibetrag von 7.200,00 EURO. Außerdem ist für die Kläger nach § 12 Abs. 2 Nr. 4 SGB II ein Freibetrag in Höhe von 3.000,00 EURO (750,00 EURO für jeden Hilfebedürftigen der Bedarfsgemeinschaft) anzusetzen. Dies führt zunächst zu einem Freibetrag von insgesamt 17.700,00 EURO mit der Folge, dass das geerbte Vermögen diesen Betrag übersteigt. Die Kammer hat auf das Vermögen der Klägerin zu 2) jedoch auch die Freibeträge nach § 12 Abs. 2 Nr. 1a SGB II (3.100,00 EURO pro Kind) angerechnet, woraus sich ein Gesamtfreibetrag von 23.900,00 EURO ergibt. Diesen Freibetrag unterschreitet das von der Klägerin zu 2) geerbte Vermögen.
In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, wie die in § 12 Abs. 2 geregelte Freibetragsregelung bei aus Eltern und Kindern bestehenden Bedarfsgemeinschaften anzuwenden ist. Während teilweise darauf abgestellt wird, dass der Freibetrag aus § 12 Abs. 2 Nr. 1a SGB II nur auf Vermögen der Kinder angerechnet werden könne und es sich nicht um einen "Kinderfreibetrag" handele, der auch den Eltern zu Gute komme (SG Reutlingen, Beschluss vom 19.02.2007, S 2 AS 565/07 ER; SG Aachen, Urteil vom 07.11.2006, S 11 AS 34/06; SG Berlin, Urteil vom 29.03.2006, S 55 AS 7521/05), bildet die 15. Kammer des Sozialgerichts Aurich einen Gesamtfreibetrag für Familien mit der Folge, dass Vermögensfreibeträge der Kinder auch auf Vermögen der Eltern angerechnet werden können (SG Aurich, Urteil vom 15.02.2006, S 15 AS 107/05). Die Kammer folgt dieser Auffassung im Ergebnis. Das SG Aurich hat seine Entscheidung unter anderem darauf gestützt, dass ein Verstoß gegen Art. 3 und 6 GG vorliege, wenn Vermögensfreibeträge Partnern nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 SGB II wechselseitig zu Gute kommen und dies in der Familie, also insbesondere im Verhältnis der Eltern zu den Kindern, nicht genauso gehandhabt wird (SG Aurich, a.a.O.)
Nach Ansicht der Kammer kann dahinstehen, ob bei der Auffassung, die im Rahmen des des § 12 Abs. 2 SGB die (überschießenden) Vermögensfreibeträge der Kinder nicht auf das Vermögen der Eltern anrechnet, tatsächlich ein Verstoß gegen Art. 3 und 6 GG anzunehmen wäre. Denn § 12 Abs. 2 SGB II ist auch ohne den Rückgriff auf eine verfassungskonforme Auslegung dahingehend auszulegen, dass zumindest dann, wenn Kinder kein eigenes Vermögen haben, deren Freibeträge auf die Eltern übertragbar sind. Hauptargument ist das auch vom SG Aurich herausgestellte "Wirtschaften aus einem Topf", das insbesondere bei Familien mit noch schulpflichtigen Kindern üblich ist. Eine getrennte Berechnung des Vermögens und der darauf anzurechnenden Freibeträge innerhalb einer Familie würde den Schutz des "Familienvermögens" von Zufälligkeiten abhängig machen. Denn wie auch das SG Aurich zutreffend ausgeführt hat, es ist oft Zufall, ob ein Sparbuch, ein Bausparvertrag oder andere Vermögenswerte auf den Namen des Kindes oder der Eltern laufen. Die Ansicht, die die Freibeträge von Eltern und Kindern getrennt ermittelt, wird Antragsteller/Leistungsbezieher vermutlich nur dazu veranlassen, Vermögensgegenstände innerhalb der Familie so zu verschieben, dass die Freibeträge möglichst ausgeschöpft werden. Dies könnte letztlich auch zu Vermögensübertragungen von den Kindern auf die Eltern führen, wenn das Vermögen eines Kindes dessen Freibetrag übersteigt. Dies dürfte nicht Sinn und Zweck des § 12 Abs. 2 Nr. 1a SGB II gewesen sein.
Um dem Willen des Gesetzgebers, der Vermögen des Kindes schützen wollte, Rechnung zu tragen, sind Freibeträge nach § 12 Abs. 2 Nr. 1a SGB II vorrangig auf das Vermögen des Kindes anzurechnen. Soweit nach Anrechnung des Vermögens jedoch ein Restfreibetrag verbleibt, ist dieser den Eltern zuzuschreiben. Der Wortlaut der Vorschrift lässt dies nicht nur zu (so SG Aurich, a.a.O.; vgl. auch Mecke in Eicher/Spellbrink, SGB II, § 12 Rn. 42), sondern legt dies nach Auffassung der Kammer sogar nahe. § 12 Abs. 2 SGB II beginnt mit den Worten "Vom Vermögen abzusetzen sind". Dieser Satzteil steht allen nachfolgenden Ziffern voran. Folgt man der Ansicht, die sich gegen einen auch den Eltern zu Gute kommenden "Kinderfreibetrag" ausspricht, müsste der allen Ziffern voranstehende Satzteil je nach Ziffer unterschiedlich gelesen werden. Für Ziffer 1. müsste es lauten: "Vom Vermögen des volljährigen Hilfebedürftigen und seinen Partners", für Ziffer 1a. "Vom Vermögen des Kindes" und für Ziffer 4. bliebe zunächst unklar, wie die Vorschrift zu lesen ist. In Rechtsprechung und Literatur wird teilweise trotz der Diskussion zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 1a SGB II nicht problematisiert, wie die Zuordnung der Freibeträge in § 12 Abs. 4 Nr. 4 SGB II vorzunehmen ist (Mecke in: Eicher/Spellbrink, SGB II, § 12 Rn. 54 f.).
Andere, die eine Trennung des Vermögens von Eltern und Kindern in § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 1a SGB II vornehmen, gehen bei § 12 Abs. 2 Nr. 4 SGB II ohne nähere Begründung davon aus, dass der Freibetrag aus § 12 Abs. 2 Nr. 2 SGB II vollständig - und somit auch die auf die Kinder entfallenden 750,00 EURO pro Person - dem Vermögen der Bedarfsgemeinschaft und somit unter Umständen auch den Eltern zu Gute kommt (SG Reutlingen, a.a.O., SG Berlin, a.a.O.). Die Tatsache, dass es in Ziffer 4. "für jeden in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Hilfebedürftigen" heißt, legt es nahe, von einem in Bezug genommenen "Vermögen der Bedarfsgemeinschaft" auszugehen, zumal notwendige Anschaffungen für Kinder in aller Regel genauso wie notwendige Anschaffungen für die Eltern oder die Familie als Ganzes aus Vermögen der Eltern bestritten werden und es daher sachwidrig wäre, die Freibeträge der Kindern den Eltern nicht zu Gute kommen zu lassen. Aus diesem Grund ist bei § 12 Abs. 2 Nr. 4 SGB II sogar noch mehr als bei § 12 Abs. 2 Nr. 1a SGB II zu fordern, Freibeträge der Kinder, die nicht für deren Vermögen benötigt werden, den Eltern zu Gute kommen zu lassen (so auch Brühl in: LPK-SGB II, § 12 Rn. 28). Dies vorausgesetzt würde der den Ziffern 1., 1a. und 4. vorangestellte Satzteil des § 12 Abs. 2 SGB II "Vom Vermögen abzusetzen sind" somit drei verschiedene Lesarten haben ("Vom Vermögen des volljährigen Hilfebedürftigen und seinen Partners", "Vom Vermögen des Kindes" und "Vom Vermögen der Bedarfsgemeinschaft"), wenn man der Ansicht folgt, die bei § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 1a SGB II eine getrennte Vermögensbewertung durchführt.
Die Kammer hält es indes für plausibler, den Begriff des Vermögens grundsätzlich einheitlich in Form eines "Bedarfsgemeinschafts-Vermögens" zu lesen und lediglich in den Fällen abzuweichen, in denen hierdurch Vermögen der Kinder ungeschützt würde und bei einer anderen Lesart geschützt wäre, um dem Sinn und Zweck von § 12 Abs. 2 Nr. 1a SGB II hinreichend Rechnung zu tragen. Dies entspricht der bei § 12 Abs. 2 SGB II vom Gesetzgeber verwendeten Gesetzestechnik, da es für eine andere Auslegung nahe gelegen hätte, eine getrennte Betrachtung der einzelnen Vermögensträger ausdrücklich zu regeln und den Satz "Vom Vermögen abzusetzen sind" nicht allen Ziffern voranzustellen.
Da die Kläger somit Freibeträge in Höhe von insgesamt 23.900,00 EURO beanspruchen können und das im Mai 2006 erworbene und im Januar 2007 zur Auszahlung gelangte Vermögen unter diesem Betrag lag, waren die Kläger auch über Januar 2007 hinaus hilfebedürftig und hatten daher weiterhin Anspruch auf Alg II. Die Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB X für eine rückwirkende Aufhebung des Bewilligungsbescheids vom 16.11.2006 lagen deshalb nicht vor. (SG Aachen S 11 AS 124/07 vom 11.09.2007)