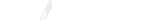Star Trek Discovery: Die vierte Staffel muss man sich nicht antun
Die Serie macht da weiter, wo die vorige Staffel aufgehört hat: Schlechte Drehbücher und Dialoge zum Fremdschämen, mit wunderbaren Spezialeffekten garniert.
Die vierte Staffel von "Star Trek: Discovery" ist nun auch in Deutschland angelaufen. Der lineare TV-Webdienst Pluto TV zeigt jeden Freitag, Samstag und Sonntag um 21 Uhr die neuste Folge kostenlos. Wer selbst bestimmen will, wann er die Serie sieht, muss knapp 3 Euro pro Folge bei Amazon
Prime Video berappen. Ob sich das lohnt, versuchen wir in dieser größtenteils spoilerfreien Rezension zu beantworten.
Erst sollte Discovery gar nicht in Europa laufen, da Rechteinhaber CBS die hiesige Vertriebs-Option von Netflix zurückgekauft hatte. Es wird spekuliert, dass CBS seinen Exklusiv-Streamingdienst Paramount+ dem Publikum hierzulande mit Star Trek Discovery schmackhaft machen will. In den USA hatte das mit den ersten Staffeln – da hieß Paramount+ allerdings noch CBS All Access – ziemlich gut funktioniert. Ob das noch einmal klappen wird, kann angesichts der Qualität der Serie allerdings bezweifelt werden. Der anfängliche Hype darum, endlich wieder frisches Star Trek im Fernsehen zu sehen, ist lange verflogen.
Von Spezialeffekten geblendet ins Plot-Loch
Zunächst einmal sei dahingestellt, dass Star Trek Discovery nach wie vor die am besten aussehende Star-Trek-Serie aller Zeiten ist. In Sachen Spezialeffekte in Fernsehserien spielt Discovery in der Champions League. Auf einem 21:9-Monitor mit entsprechendem Soundsystem ist die Serie optisch und akustisch geradezu atemberaubend. Man hat in den ersten beiden Folgen der vierten Staffel sogar das Gefühl, dass die Macher im Vergleich zu den ersten drei Staffeln hier sogar noch draufgelegt haben.
Leider kann der optische Bombast wie schon in früheren Staffeln nicht darüber hinwegprotzen, dass die Drehbuchautoren eher Kreisklasse sind. Und hier scheint es, als ob die Dialoge und Plots im Vergleich zu früheren Staffeln eher noch schlechter werden. Schon die ersten beiden Folgen offenbaren gravierende Plot-Löcher und Dialoge, bei denen der Fremdschäm-Faktor fast unerträglich ist.
Bisher können wir nur von zwei Folgen der Staffel ausgehen, insgesamt soll sie dreizehn Folgen umfassen. Aber diese ersten beiden Folgen deuten daraufhin, dass Star Trek Discovery da weitermacht, wo die Serie in Staffel 3 aufgehört hat. Mit anderen Worten, wem Discovery bisher gefallen hat, der wird auch hier wieder glücklich. Fans vom Star Trek der achtziger, neunziger und zweitausender Jahre werden es wohl kaum.
Immer wieder Deus-Ex-Machina
Eine Discovery-Staffel läuft immer etwa gleich ab und auch Staffel 4 scheint hier keine Ausnahme zu sein: Das Universum ist von der kompletten Vernichtung bedroht. Aus irgendeinem Grund, den man kaum versteht, und der auch meist am Ende der Staffel keinen Sinn ergibt, kann nur Michael Burnham das Universum retten. Sei es, weil ihre Mutter oder ihr Bruder oder ihr Captain, oder in dieser Staffel nun ihr Freund, involviert ist. Und weil Michael Burnham natürlich etwas ganz Besonderes ist.
Aber das weiß Michael Burnham nicht und deswegen muss sie verzweifeln. Am Ende triumphiert sie dann natürlich doch, tränenreich und pathetische Reden schwingend. Auf dem Weg dorthin springt die Discovery mit ihrem Pilzantrieb quer durch die Galaxis und hilft so manchem Planeten. Aber irgendwie bleibt davon am Ende immer wenig hängen, die Geschichten der einzelnen Folgen wirken belanglos.
Star Trek Discovery ersetzt gute Drehbücher mit echten Emotionen und durchdachten Geschichten durch ein Deus-Ex-Machina nach dem anderen. Wie die Gefahr taucht auch die Möglichkeit ihrer Abwehr unvermittelt aus der Tiefe des Weltraums auf – und verschwindet genauso schnell wieder. Bloß nicht zu lange drüber nachdenken, sonst würde man ja merken, wie wenig Sinn das unter dem ganzen Effektfeuerwerk ergibt.
Ein gutes Beispiel ist die Weltenvernichtungsmaschinerie, die wir in der aktuellen Staffel präsentiert bekommen. Eine Gravitationsanomalie, die größer als der Abstand unserer Sonne zu ihrem nächsten Nachbarn Proxima Centauri ist, und deren Position niemand vorhersagen kann. Wer sich mal mit einem heißen Earl Grey fünf Minuten hinsetzt und über diese Drehbuch-Idee nachdenkt, dem wird mehr als ein Punkt einfallen, der hier erst mal keinen Sinn ergibt. Natürlich kann es sein, dass die Autoren am Ende alles restlos erklären. Aber nach den ersten drei Staffeln darf man daran getrost zweifeln. Die Plot-Löcher bei Discovery sind mittlerweile so groß, dass ihre Masse bereits das Raum-Zeit-Kontinuum des Universums verbiegt.
Du musst angemeldet sein, um Medien zu sehen.
Dialoge zum Fremdschämen
Unlogische Momente im Plot finden sich aber auch im Kleinen – zum Beispiel, wenn die Autoren lustig sein wollen. Tilly muss dem Captain eine wichtige Mitteilung machen, es geht um Sekunden. Sie hastet vom Maschinenraum auf die Brücke, anstatt einfach den fancy Holo-Kommunikator auf der Brust zu verwenden – mit dem sie sich übrigens auch im Bruchteil einer Sekunde auf die Brücke hätte beamen können. Für einen müden Lacher wird die Crew zum zweiten Mal innerhalb von Minuten aus knapp zweieinhalb Metern Höhe auf den Schiffsboden geschleudert – Rippenbruch inklusive.
Nur weil Tilly – angeblich ein extrem schlaues Genie, wie wir immer wieder gesagt bekommen, und jetzt sogar zum Lieutenant befördert – zu dumm ist, den allgegenwärtigsten Ausrüstungsgegenstand eines Sternenflottenoffiziers überhaupt zu nutzen. Und das sollen wir glauben? Da verabschiedet sich jeder Rest von gutem Willen, den man noch hatte, sich auf die Schrulligkeit dieser Serie einzulassen.
Die hölzernen Dialoge des neuen Captains mit ihrer Armada von unbeholfenen Science-Geeks und "Wir sind die Sternenflotte"-Helden auf der Brücke lassen auch nicht annähernd so etwas wie echte Trek-Atmosphäre aufkommen. Obwohl die Gespräche den Zuschauer immer wieder mit der Nase darauf stoßen sollen, wie supertoll und inklusiv das alles doch ist, so wirkt es doch nur umso steriler. Wenn nicht sowieso gerade wieder das Fremdschämen einsetzt, weil jemand scchon wieder etwas unglaublich Dummes gesagt hat.
Vielleicht liegt es an Michaels unsympathischem Messias-Komplex. Vielleicht daran, dass dieses Schiff jede Staffel mindestens einmal den Captain wechselt. Oder vielleicht liegt es schlicht daran, dass die Dialoge einfach nicht glaubwürdig sind, aber man fühlt sich auf dieser Brücke einfach nicht wohl. Wo man Kirks eisernen Willen bewundert, mit Picard gerne einfach nur bei einem Earl Grey über Shakespeare philosophieren will, mit Sisko auf dem Holodeck ein paar Bälle werfen würde, mit Janeway das allmorgendliche Kaffee-Ritual zelebriert und Archer mit einem Scotch zu-toastet, will man mit Michael Burnham einfach nichts zu tun haben. Man hat das Gefühl, dass Burnhams Charakter gänzlich aus dem Weltrettungskomplex besteht. Schon sich vorzustellen, dass diese Person so etwas wie Hobbies hat, fällt schwer.
Das fliegende Rehabilitationszentrum
Star Trek war vor allem immer deswegen so menschlich und lebensbejahend, weil jede Serie bisher Außenseiter – allerhand Nerds und Figuren, die anders aussehen, anders fühlen oder anders denken – in eine Crew integriert hat, die diese mit offenen Armen und familiärer Hingabe empfing. Die Macher von Discovery haben aber nicht verstanden, warum das funktioniert hat: Die Crews bestanden grundsätzlich aus Normalos. Gut, wir finden dann später raus, dass irgendwie alle ein bisschen special sind und ihre eigenen Probleme haben, aber zuvorderst sind sie Offiziere in einer militärischen Organisation und fast alle von denen sind so körperlich und geistig fit, wie wir das wohl alle gerne wären.
Soll heißen: Diese ganze Integrations-Geschichte funktioniert nur, wenn man sieht, wie die "Anderen" mit den "Normalen" zusammenleben und arbeiten. Dass Data herausfinden kann, was Gefühle sind, funktioniert nur, weil der Rest der TNG-Crew mehr oder weniger normale Gefühle hat. Und die Integration von Seven in die Voyager-Crew lebt vom Kontrast der Borg-Drohne zu den mehr oder weniger normalen Spezies, die Angst vor den Borg haben.
Bei Discovery dagegen sind alle komplett gaga. Was in einer Sitcom funktionieren mag, ergibt aber noch lange keine glaubhafte Sternenflotten-Crew. Die Geschichte der geschlechterdiversen Adira und ihres anders diversen Trill-Symbionten ist so verwirrend, dass der Zuschauer einfach aussteigt und lieber die Komplexitäten ignoriert, als sich dafür zu interessieren. Die schlechten Dialoge tragen ihr Möglichstes dazu bei, das Publikum noch weiter zu verwirren, obwohl sie anscheinend genau das Gegenteil bezwecken sollen. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser emotionale Wust die viel interessantere und, ehrlich gesagt herzallerliebste, Liebesbeziehung zwischen Paul Stamets und Hugh Culber komplett in den Hintergrund verdrängt, was ehrlich gesagt eine Schande ist.
Die Serie ist die Zeit nicht wert
Man hat durchgehend das Gefühl, dass der Writers' Room von Star Trek: Discovery das Herz am rechten Fleck hat. Es mangelt aber anscheinend am grundlegenden Verständnis daran, wie man eine gute Geschichte oder auch nur annähernd glaubhafte Dialoge schreibt. Oder was Star Trek ausmacht. Und so versinkt eine Serie, die wunderschön aussieht, in obskurem Unsinn, der außer den oberflächlichsten Branding-Artefakten nichts mehr mit Star Trek zu tun hat. Die Folgen sind nicht aufgebaut wie Star-Trek-Folgen, die Figuren verhalten sich nicht wie Sternenflottenoffiziere und statt zeitgemäßen Problemen und raffinierten Lösungen gibt es grobschlächtigen Bühnenzauber und viel hohles Pathos. Und alles, was in den ersten drei Staffeln schon schlecht war, scheint eher schlimmer als besser zu werden.
Ob man dafür 3 Euro pro Folge bei Amazon
Prime Video hinlegen will, ist zu bezweifeln. Der Autor dieser Rezension würde sich für weitere kostenlose Folgen Discovery nicht mal Freitags um neun vor seinen Rechner setzen. Dafür ist ihm seine Zeit zu schade. Nicht, wenn auf Netflix sieben ganze Staffeln Deep Space Nine darauf warten, jederzeit gesehen zu werden. Da ist das Bühnenbild zwar nicht so schön, aber die Atmosphäre ist menschlicher. Und gesünder fürs Hirn.
Quelle; heise