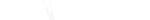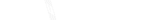Ein Kölner Gericht hat die fast 70-jährige Mutter eines Freifunkers als Anschlussinhaberin wegen eines Download-Angebots dazu verdonnert, 2000 Euro zu zahlen.
Die vor drei Jahren in Kraft getretene Reform der WLAN-Störerhaftung wird von der Judikative zunehmend nicht im Sinne des Gesetzgebers interpretiert. Aktuelles Beispiel: Das Amtsgericht Köln hat die fast 70-jährige Mutter eines Freifunk-Anbieters auf Antrag von Warner Bros. Entertainment des "illegalen Filesharings" für schuldig befunden. Die betagte Dame, die keinen eigenen Computer besitzt und den auf ihren Namen laufenden Internetzugang selbst gar nicht verwendet, soll dem Filmstudio daher Schadenersatz in Höhe von 2000 Euro zahlen.
Hausgemeinschaft nutzt offenes Netz
Über die gerichtliche Auseinandersetzung (Az. 148 C 400/19) berichtet die Berliner Rechtsanwältin Beata Hubrig, die selbst Freifunkerin ist. Der Betrieb von Software zur Teilnahme an Peer-to-Peer-Netzwerken war der Verurteilten demnach "komplett fremd". Sie selbst habe den Festnetzanschluss genutzt, ihre Familie, Freunde und Besucher hingegen den damit verknüpften Internetzugang. Dies sei eine "nicht ganz ungewöhnliche Situation": Wenn Menschen zusammenlebten, teilten sie oft ihren Anschluss. Wer – wie die Kölner Hausgemeinschaft – ein freies Netz wolle, setze dabei oft auch bewusst keinen Verschlüsselungstunnel etwa über ein Virtual Private Network (VPN) ein.
Konkret habe in dem Fall ein Dienstleister mithilfe eines forensischen Systems eine Person ermittelt, die in einer Tauschbörse offenbar eine urheberrechtlich geschützte Datei zum Download angeboten habe, erläutert die Juristin. Dies stelle nach dem Urheberrechtsgesetz eine unerlaubte Handlung dar. Der vermutliche Anbieter sei über die IP-Adresse bis zu einem spezifischen Internetanschluss verfolgt worden.
Anschlussinhaber müssen Unschuld darlegen
Im Rahmen eines "Gestattungsbeschlusses" des zuständigen Landgerichts habe die Deutsche Telekom, die die IP-Adressen verdachtsunabhängig aus Sicherheitsgründen sieben Tage lang speichert, als Provider die ladungsfähige Adresse der Mutter des Freifunkers herausgegeben, führt Hubrig aus. "Warner Bros. mahnte sie daraufhin ab", ohne zu wissen, ob die Mutter ihren Anschluss allein nutzt und die Urheberrechtsverletzung von ihr begangen wurde. Mit der Abmahnung habe der Filmproduzent eine pauschale Summe als Wiedergutmachung verlangt, ohne den tatsächlichen Schaden darzulegen. Dass Filesharing Rechteinhabern überhaupt nennenswerte Einbußen beschere, sei jedoch "bereits widerlegt".
Das Amtsgericht folgte dem Antrag von Warner Bros. mit dem Beschluss vom 8. Juni trotzdem im Kern. Die Begründung des Urteils fasst laut der Freifunk-Anwältin "exemplarisch eine gefährliche Entwicklung zusammen, die in vielen Fällen tendenziöser Rechtsprechung der letzten Zeit deutlich wurde". In solchen Urheberrechtsverfahren müssten Anschlussinhaber neuerdings darlegen, "dass sie als Täter nicht in Frage kommen, teilweise sollen sie dies sogar beweisen".
Auf diese Art räumten Richter den Rechteinhabern "einen prozessualen Vorteil ein". Sie müssten selbst keine Tatsachen vortragen, durch die sie ihre Ansprüche begründen. Vielmehr werde der Gegner einer diffusen "sekundären Darlegungslast" ausgesetzt, seine Unschuld zu beweisen.
Störerhaftung lebt trotz allem
Der Bundestag hatte dagegen Mitte 2017 eine Novelle des Telemediengesetzes beschlossen, um der Störerhaftung im zweiten Anlauf doch noch den Garaus zu machen. Laut dem Prestigeprojekt der Großen Koalition sollen Inhaber von Urheberrechten von Hotspot-Anbietern weder Schadenersatz noch Abmahngebühren verlangen können, wenn sie feststellen, dass über das drahtlose Zugangsnetz unerlaubt geschützte Werke etwa per Filesharing illegal verbreitet werden.
Im Gegenzug gab der Gesetzgeber Rechteinhabern die Option in die Hand, mit Websperren gegen wiederholte Copyright-Verstöße vorzugehen. Die Kosten für eine solche Anordnung muss aber der Antragsteller tragen, was der Film- und Musikindustrie von Anfang an ein Dorn im Auge war.
Anschlussinhaber müssten Nutzerverhalten überwachen
Hubrig zufolge hat sich inzwischen eine Rechtsprechung etabliert, die den Anschlussinhaber "erst aus der Tätervermutung entlässt", wenn er einen Dritten als Ersatz benennen könne. Dies führe in der Praxis dazu, dass die Vertragspartner der Zugangsanbieter widerrechtlich "das Nutzerverhalten Dritter für den Fall einer Abmahnung überwachen" müssten. Die Bundesregierung hatte voriges Jahr bereits eingeräumt, dass das "WLAN-Gesetz" nur bedingt zu mehr Rechtssicherheit bei öffentlichen Hotspots geführt und den Anbietern nur ein "leichtes Durchatmen" ermöglicht habe.
Ob die vermeintliche "Raubkopier-Oma" in Berufung geht, steht laut Hubrig noch nicht fest. Problematisch sei jenseits der Kosten "die seelische Belastung, die ein solches Verfahren mit sich bringt". Der Rechtsstreit werde zudem wohl auch in der zweiten Instanz die heikle Forderung "nach der Suche des Täters beinhalten".
Quelle; heise
Die vor drei Jahren in Kraft getretene Reform der WLAN-Störerhaftung wird von der Judikative zunehmend nicht im Sinne des Gesetzgebers interpretiert. Aktuelles Beispiel: Das Amtsgericht Köln hat die fast 70-jährige Mutter eines Freifunk-Anbieters auf Antrag von Warner Bros. Entertainment des "illegalen Filesharings" für schuldig befunden. Die betagte Dame, die keinen eigenen Computer besitzt und den auf ihren Namen laufenden Internetzugang selbst gar nicht verwendet, soll dem Filmstudio daher Schadenersatz in Höhe von 2000 Euro zahlen.
Du musst Regestriert sein, um das angehängte Bild zusehen.
Hausgemeinschaft nutzt offenes Netz
Über die gerichtliche Auseinandersetzung (Az. 148 C 400/19) berichtet die Berliner Rechtsanwältin Beata Hubrig, die selbst Freifunkerin ist. Der Betrieb von Software zur Teilnahme an Peer-to-Peer-Netzwerken war der Verurteilten demnach "komplett fremd". Sie selbst habe den Festnetzanschluss genutzt, ihre Familie, Freunde und Besucher hingegen den damit verknüpften Internetzugang. Dies sei eine "nicht ganz ungewöhnliche Situation": Wenn Menschen zusammenlebten, teilten sie oft ihren Anschluss. Wer – wie die Kölner Hausgemeinschaft – ein freies Netz wolle, setze dabei oft auch bewusst keinen Verschlüsselungstunnel etwa über ein Virtual Private Network (VPN) ein.
Konkret habe in dem Fall ein Dienstleister mithilfe eines forensischen Systems eine Person ermittelt, die in einer Tauschbörse offenbar eine urheberrechtlich geschützte Datei zum Download angeboten habe, erläutert die Juristin. Dies stelle nach dem Urheberrechtsgesetz eine unerlaubte Handlung dar. Der vermutliche Anbieter sei über die IP-Adresse bis zu einem spezifischen Internetanschluss verfolgt worden.
Anschlussinhaber müssen Unschuld darlegen
Im Rahmen eines "Gestattungsbeschlusses" des zuständigen Landgerichts habe die Deutsche Telekom, die die IP-Adressen verdachtsunabhängig aus Sicherheitsgründen sieben Tage lang speichert, als Provider die ladungsfähige Adresse der Mutter des Freifunkers herausgegeben, führt Hubrig aus. "Warner Bros. mahnte sie daraufhin ab", ohne zu wissen, ob die Mutter ihren Anschluss allein nutzt und die Urheberrechtsverletzung von ihr begangen wurde. Mit der Abmahnung habe der Filmproduzent eine pauschale Summe als Wiedergutmachung verlangt, ohne den tatsächlichen Schaden darzulegen. Dass Filesharing Rechteinhabern überhaupt nennenswerte Einbußen beschere, sei jedoch "bereits widerlegt".
Das Amtsgericht folgte dem Antrag von Warner Bros. mit dem Beschluss vom 8. Juni trotzdem im Kern. Die Begründung des Urteils fasst laut der Freifunk-Anwältin "exemplarisch eine gefährliche Entwicklung zusammen, die in vielen Fällen tendenziöser Rechtsprechung der letzten Zeit deutlich wurde". In solchen Urheberrechtsverfahren müssten Anschlussinhaber neuerdings darlegen, "dass sie als Täter nicht in Frage kommen, teilweise sollen sie dies sogar beweisen".
Auf diese Art räumten Richter den Rechteinhabern "einen prozessualen Vorteil ein". Sie müssten selbst keine Tatsachen vortragen, durch die sie ihre Ansprüche begründen. Vielmehr werde der Gegner einer diffusen "sekundären Darlegungslast" ausgesetzt, seine Unschuld zu beweisen.
Störerhaftung lebt trotz allem
Der Bundestag hatte dagegen Mitte 2017 eine Novelle des Telemediengesetzes beschlossen, um der Störerhaftung im zweiten Anlauf doch noch den Garaus zu machen. Laut dem Prestigeprojekt der Großen Koalition sollen Inhaber von Urheberrechten von Hotspot-Anbietern weder Schadenersatz noch Abmahngebühren verlangen können, wenn sie feststellen, dass über das drahtlose Zugangsnetz unerlaubt geschützte Werke etwa per Filesharing illegal verbreitet werden.
Im Gegenzug gab der Gesetzgeber Rechteinhabern die Option in die Hand, mit Websperren gegen wiederholte Copyright-Verstöße vorzugehen. Die Kosten für eine solche Anordnung muss aber der Antragsteller tragen, was der Film- und Musikindustrie von Anfang an ein Dorn im Auge war.
Anschlussinhaber müssten Nutzerverhalten überwachen
Hubrig zufolge hat sich inzwischen eine Rechtsprechung etabliert, die den Anschlussinhaber "erst aus der Tätervermutung entlässt", wenn er einen Dritten als Ersatz benennen könne. Dies führe in der Praxis dazu, dass die Vertragspartner der Zugangsanbieter widerrechtlich "das Nutzerverhalten Dritter für den Fall einer Abmahnung überwachen" müssten. Die Bundesregierung hatte voriges Jahr bereits eingeräumt, dass das "WLAN-Gesetz" nur bedingt zu mehr Rechtssicherheit bei öffentlichen Hotspots geführt und den Anbietern nur ein "leichtes Durchatmen" ermöglicht habe.
Ob die vermeintliche "Raubkopier-Oma" in Berufung geht, steht laut Hubrig noch nicht fest. Problematisch sei jenseits der Kosten "die seelische Belastung, die ein solches Verfahren mit sich bringt". Der Rechtsstreit werde zudem wohl auch in der zweiten Instanz die heikle Forderung "nach der Suche des Täters beinhalten".
Quelle; heise